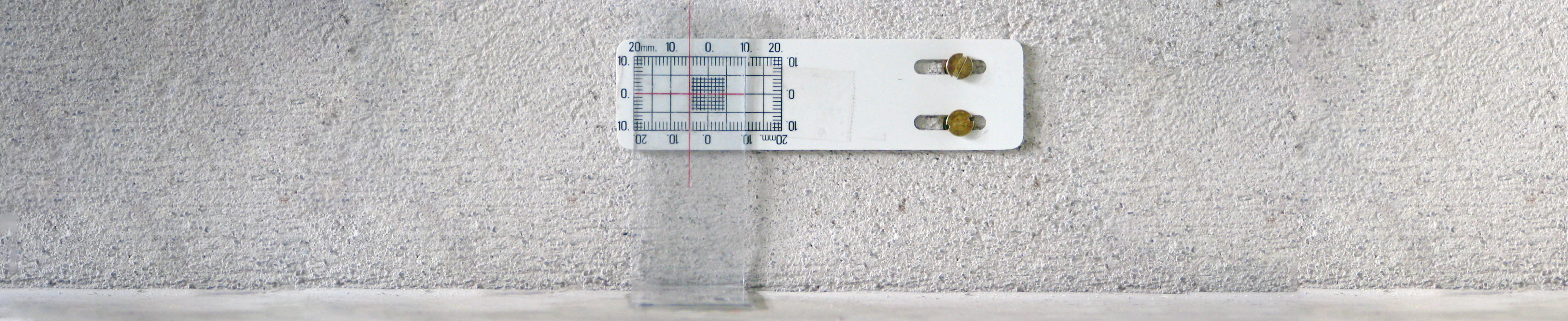Zurzeit werden die im Folgenden aufgeführten Forschungsprojekte bearbeitet:
„Erfassung der Hintergrundkonzentrationen von Schimmelbefall in nicht durch Feuchte geschädigten Bodenaufbauten vor Modernisierung oder Abriss von Gebäuden oder Gebäudeteilen“
Fördermittelgeber:
„Zukunft Bau Forschungsförderung“ des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
Gegenstand und Ziel der Förderung:
Sachverständige für Schäden an Gebäuden müssen regelmäßig Bodenaufbauten beurteilen, die nach Nutzwasserschäden oder Abdichtungsfehler – aktuell auch durch Überschwemmung – zumindest zeitweise durchfeuchtet waren. Dabei geht es häufig um die Wiederherstellung eines Zustands vor Schadenseintritt. Neben der technischen Funktion der Dämmschichten, z. B. die verbliebene Druckfestigkeit und Dimensionsstabilität, ist auch zu klären, ob durch das Schadensereignis Schimmelbefall im Bodenaufbau entstanden ist und ob dieser Auswirkungen auf die Innenraumhygiene haben kann.
Allerdings gibt es keine Beurteilungskriterien bezüglich der üblichen Beschaffenheit von Fußbodenaufbauten. Der Schimmelleitfaden des Umweltbundesamtes nennt zwar Daten, allerdings nur als erste Orientierungswerte, die nicht validiert sind. Es fehlen empirisch ermittelte Daten zur üblichen Beschaffenheit von Fußbodenaufbauten in nicht geschädigten Gebäuden, die schon eine gewisse Zeit genutzt wurden.
Mit der Forschungsarbeit soll eine Datengrundlage entstehen als Entscheidungshilfe, ob Fußböden ausgebaut werden müssen oder fallbezogen verbleiben können.
Dafür werden Gebäude gesucht, deren Fußböden mit Dämmschichten z. B. wegen bevorstehender Abriss- oder Umbaumaßnahmen zerstörend untersucht werden können. Dort möchten wir an verschiedenen Stellen des Bodens Proben des Aufbaus entnehmen und nach einem einheitlichen Laborverfahren untersuchen.
Wir uns würden freuen, wenn Sie uns bei der Forschungsarbeit unterstützen und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, möglicherweise unnötige Baumaßnahmen mit Ressourcenverbrauch, Kosten und Müllentstehung vermeiden helfen ohne dabei die Innenraumhygiene einzuschränken. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns dazu Gebäude z. B. mit diesem Antwortbogen benennen könnten, in den wir im laufenden oder im kommenden Jahr Proben entnehmen können.
Projektdauer:
2021 – 2024
Auswaschungen von Flachdächern und stoffliche Belastung im abfließenden Niederschlagswasser“,
Aktenzeichen: SWD-10.08.18.7-23.29
Fördermittelgeber:
Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat II 3, Bonn im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau
Gegenstand und Ziel der Förderung:
Stoffe und Bauteile dürfen während der Nutzung sich nicht schädigend auf ihre Umwelt auswirken. Dahingehend sind Produkte nach bestimmten Kriterien zu prüfen. Bauprodukte werden lediglich unter Laborbedingungen und nur nach Stoffen geprüft, die in der EU-Biozid-Richtlinie aufgeführt sind. Alle anderen darin nicht aufgeführten, aber verwendeten, biozid wirkenden Stoffe sind davon nicht erfasst. Auch bilden die Bedingungen im Labor bei einem Klima von 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte nicht die Realität ab. Sie werden Dachbahnen im üblichen Betrieb deutlich wärmer und lösliche Stoffe, die bei 20 °C noch nicht ausgewaschen werden, können sich bei z. B. 50 °C lösen.
Im realen Betrieb wird Niederschlagswasser von Dachflächen ohne weitere Prüfung auf Bestandteile abgeleitet. Dabei können nicht zu deklarierende Biozide, Öle oder offiziell nicht zu den Bioziden zu rechnenden Schwermetalle ausgewaschen werden, die in das Grundwasser bzw. in die Umwelt gelangen.
Mit der Forschungsarbeit soll eine ganzheitliche Prüfung von an Dächern üblichen Dachbahnen vorgenommen werden, welche tatsächlich unter realen Bedingungen ausgewaschen werden können. Ziel des Forschungsvorhabens ist die Erarbeitung von Empfehlungen für zu prüfende Stoffe und Prüfbedingungen, nach denen Dachbahnen auf Kunststoff- und Bitumenbasis untersucht werden können. Es soll festgestellt werden, ob und welche Dachabdichtungsschichten nicht unter Laborprüfbedingungen, jedoch im eingebauten Zustand dazu neigen, unerwünschte Stoffe über das Niederschlagswasser abzugeben. Aus den Objektuntersuchungen sollen bestehende Laborprüfbedingungen weiterentwickelt werden, die eine bauartbezogene Prognose über abgegebene Stoffe zulassen.
Ein weiteres Ziel besteht darin, in Fällen, in denen Stoffe abgegeben werden, Instandsetzungsverfahren zu ermitteln, die es ermöglichen, vorhandene Dachabdichtungen, die mit Ausnahme der Stoffauswaschungen sonst uneingeschränkt verwendungsgeeignet sind, nicht vorzeitig austauschen zu müssen.
Mit verbesserter Kenntnisse zu den Stofffreisetzungen sollen emissionsmindernde Maßnahmen besser identifiziert werden und Planern, Gutachtern sowie Herstellern Hinweise zu Problembereichen gegeben können. Damit lassen sich aufwändige nachgeschaltete Barrieremaßnahmen (Behandlungsanlagen), die hohe Kosten in Erstellung und Betrieb verursachen, vermeiden.
Die Ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst. Dieser soll Sachverständigen, Fachplanern und Dachdeckerunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Einerseits sollen sich negativ auf die Umwelt auswirkende Dachbahnen, Materialgruppen oder Stoffe benannt und damit erkannt werden können. Andererseits sollen für neue Bauarten Anforderungen formuliert werden, damit zukünftig diese Art von Umweltauswirkungen von vornherein vermieden werden können.
Projektdauer:
2024- 2026
„Brandschutzanforderungen an Flachdachaufbauten unter Photovoltaikanlagen“
Aktenzeichen: SWD-10.08.18.7-23.16
Fördermittelgeber:
Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat II 3, Bonn im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau
Gegenstand und Ziel der Förderung:
Für die Installation von Photovoltaikanlagen stehen Ressourcen in großem Umfang zur Verfügung, die bislang nur zu einem kleinen Teil genutzt werden, nämlich Dächer. Von diesen werden insbesondere Flachdächer aufgrund der Möglichkeit, Solargeneratoren wirtschaftlich aufzustellen, in den Fokus rücken. Risiken, die sich zum Beispiel durch eine erhöhte Brandgefahr ergeben (im Vergleich zu einer Dachfläche ohne Photovoltaikanlage), dürfen nicht unterschätzt werden. Eine Vielzahl von Veröffentlichungen beschäftigt sich, wie oben erläutert, mit den Brandschutzanforderungen an die Module und Komponenten der Photovoltaikanlage bzw. hat den Schutz der Einsatzkräfte im Brandfall zum Thema.
Es fehlen jedoch konkrete Angaben zu den erforderlichen Eigenschaften der Flachdachaufbauten, auf denen die Photovoltaikanlagen aufgestellt werden, um eine Fortleitung des Brandes auf das Gebäude sicher zu vermeiden. Derzeit gibt es keine verlässliche Datengrundlage hinsichtlich eines eventuellen Risikos durch Photovoltaikanlagen auf Dächern. Daher ist nach dem Vorsorgeprinzip zu ermitteln, welche Brandlasten durch die Anlagen tatsächlich vorliegen, welche Schwachstellen zu Bränden führen können, welche Anlagenteile selbst brennbar und brandfortleitend sind. Nach dieser Abschätzung der Brandlasten ist abzuleiten, welche Anforderungen an Dachaufbauten von Flachdächern zu stellen sind, deren Abdichtungen grundsätzlich aus Werkstoffen bestehen, die nicht nicht brennbar sind, sondern lediglich die Anforderungen an „harte Bedachungen“ erfüllen.
Dies soll im Forschungsprojekt zum einen durch eine Ermittlung/Zusammenstellung tatsächlicher Brandlasten und Risiken sowie der daraus resultierenden Einwirkungen durch einen Photovoltaikanlagen-Brand auf die Dachaufbauten von Flachdächern erfolgen.
Die Forschungsarbeit beschäftigt also sich zweistufig mit folgenden Themen:
1. Ermittlung und Zusammenstellung von bereits existierenden Veröffentlichungen zu tatsächlichen Brandlasten und Risiken sowie der draus resultierenden Einwirkungen durch einen Photovoltaikanlagen-Brand auf die Dachabdichtungen von Flachdächern. Dies erfolgt, um die derzeitigen Annahmen für Brandeinwirkungen zu überprüfen und ggf. anzupassen. Erste Umfragen der Antragsteller unter Unternehmen, die Solaranlagen installieren, sowie bei Mitarbeitern von Feuerwehren deuten darauf hin, dass Brandlasten durch Photovoltaikanlagen tatsächlich größer sind als bislang angenommenen.
2. Anhand dieser Ergebnisse sind die bestehenden Anforderungen an Dachabdichtungen zu validieren. Nach jetziger Abschätzung genügen diese nicht als Voraussetzung, Photovoltaikanlagen auf Flachdachabdichtungen zu installieren ohne ernste Risiken durch mögliche Brände einzugehen. Deswegen sollen Handlungsempfehlungen entwickelt werden, um Photovoltaikanlagen auf Flachdächern ohne zusätzliche Risiken für Gebäude betreiben zu können.
Projektdauer:
2024 – 2026
![]()